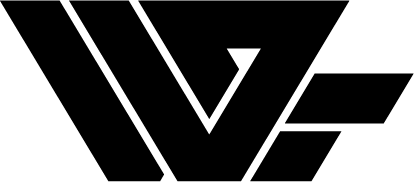Aufbruch, Anspruch und Selbstverständlichkeit – warum wir eine ganze Ausgabe Frauen auf dem Rad widmen!
von Anne-Katrin
Wer an Fahrradbranche, Mobilitätsplanung, Radreisen oder Radsport denkt, sieht oft vor allem eines: Männer. Sie sind es, die in Werkstätten stehen, auf Messeständen repräsentieren, medial präsente Rennen gewinnen, in Verbänden sprechen, Planungsbüros leiten und technische Entwicklungen bestimmen. Frauen, FLINTA* und queere Personen? Oft kaum sichtbar – und noch seltener repräsentiert. Genau deshalb widmen wir diese Ausgabe dem Thema Women in Cycling. Nicht als Sonderfall, nicht als Nische. Sondern, weil es Zeit ist, genau hinzusehen: auf Strukturen, auf Unsichtbares, auf verpasste Chancen und auf Menschen, die neue Wege gehen.
Sichtbarkeit schafft Veränderung
Ob beim Radfahren im Alltag, im Ehrenamt, auf langen Bikepacking-Touren oder im Profisport – weiblich gelesene Personen haben oft andere Anforderungen, Perspektiven und Erfahrungen. Und die finden viel zu selten Eingang in Produkte, Planungen oder Politik. So sind Rahmengrößen und Geometrien nach wie vor häufig auf durchschnittlich männliche Körper ausgelegt. Zyklusorientiertes Training? Bikefitting speziell für die weibliche Anatomie? Noch viel zu wenig erforscht. FLINTA*-Schraubkurse? Oft ehrenamtlich und unterfinanziert. Und als weibliche Geschäftsführerin begegnen einem schon mal irritierte Blicke: „Neulich hat mich ein Händler gefragt, ob ich was im Marketing mache – als ich dann sagte, dass ich die Geschäftsführerin von i:SY bin, war sein Gesicht unbezahlbar“, so Jessica Schumacher im Interview mit uns.
Alltag: komplexer, spontaner, unsichtbarer
Auch der Blick auf die Alltagsmobilität zeigt eine strukturelle Schieflage. Laut dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) und der von April 2023 bis Juli 2024 durchgeführten Studie Mobilität in Deutschland (MiD) legen Frauen im Schnitt mehr Wege pro Tag zurück – aber kürzere. Statt klarer Pendelrouten, wie sie bei Männern häufig vorkommen, bewältigen viele Frauen sogenannte Kettenwege: Kita – Supermarkt – Arzt – Arbeit. Sie begleiten Kinder, pflegen Angehörige, erledigen Besorgungen – spontan, komplex, multimodal. Doch geplant wird der Verkehr noch immer für das Auto, für Erwerbsarbeit, für lineare Wege. Die Bedürfnisse derer, die Versorgungsleistungen übernehmen, bleiben zu oft außen vor. „Will man geschlechtsspezifische Unterschiede beim Zugang zu Mobilität verstehen, muss man die Kombination aus Geschlecht und Lebensphase berücksichtigen“, so der VCD. Eine gerechte Verkehrswende muss deshalb feministisch gedacht werden – inklusiv, alltagsnah und bedürfnisorientiert.
Branche, Planung, Politik: noch immer unterrepräsentiert
Die Zahlen sprechen für sich: Der Frauenanteil an allen Leitungsfunktionen im Bundesministerium für Digitales und Verkehr liegt bei 38 Prozent, in der Stadtplanung bei 33 Prozent und in den Vorständen der 50 größten Verkehrsunternehmen in Deutschland bei gerade mal 5,6 Prozent. “All das hat massive Auswirkungen darauf, wie unsere künftige Mobilität aussehen wird”, so Meike Wenzl, Managerin bei accilium. Das hat Folgen. Wer nicht mit am Tisch sitzt, kann auch nicht mitentscheiden – über Mobilität, über Budgets, über Sicherheit.
Sport: gleiche Leistung, ungleicher Lohn
Der Tour de France-Sieger erhält 500.000 Euro – die Tour-Siegerin nur 50.000 Euro. Das Preisgeld der Männer ist damit zehnmal so hoch. „Das ist ein gewaltiger Unterschied und das ist sehr enttäuschend. Es gibt noch viel zu tun“, sagt Demi Vollering vom Team FDJ-SUEZ im Interview mit der Deutschen Welle. Auf die ungleichen Siegprämien angesprochen, reagiert Marion Rousse, Direktorin der Tour de France Femmes, genervt: „Die Frage nach den Siegprämien begleitet mich seit der ersten Auflage der Tour de France Femmes und das nervt mich ehrlich gesagt etwas.“ Sie verweist auf strukturelle Unterschiede: „Es ist schwierig, ein Rennen mit 21 Renntagen und eines mit neun Tagen zu vergleichen“, so Rousse. Durch die geringere Etappenanzahl gebe es weniger Sponsoring- und TV-Einnahmen. Doch die größte Lücke klafft bei den Gehältern. Während Topfahrer wie Tadej Pogačar laut cyclingnews.com rund 8,2 Millionen Euro im Jahr verdienen, liegt das Einkommen von Topfahrerinnen wie Demi Vollering bei rund 900.000 Euro – also nicht einmal einem Achtel.
Fazit: Wir brauchen mehr als nur Sichtbarkeit. Wir müssen gesellschaftliche Rollenbilder hinterfragen, Versorgungsarbeit neu verteilen und FLINTA*-Perspektiven aktiv in den Mittelpunkt stellen. Eine gerechtere Mobilität entsteht nicht von allein – sie muss gestaltet werden. Von allen. Für alle. Diese Ausgabe ist ein Anfang. Eine Einladung. Und ein Statement: Women in Cycling ist kein Randthema – es ist zentral für die Zukunft unserer Mobilität.
Quellen:
https://www.vcd.org/artikel/feministische-verkehrspolitik
https://www.mobilitaet-in-deutschland.de/
https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/mFUND/Aktuell/gender-gap-in-der-mobilitaetsbranche.html
https://www.dw.com/de/tour-de-france-femmes-gleichberechtigt/a-73354151
https://www.linexo.de/presse/studien/2024/aktive-mobilitaet-und-lastenrad
https://www.cyclingnews.com/features/cyclings-rich-list-who-are-the-sports-highest-earners/